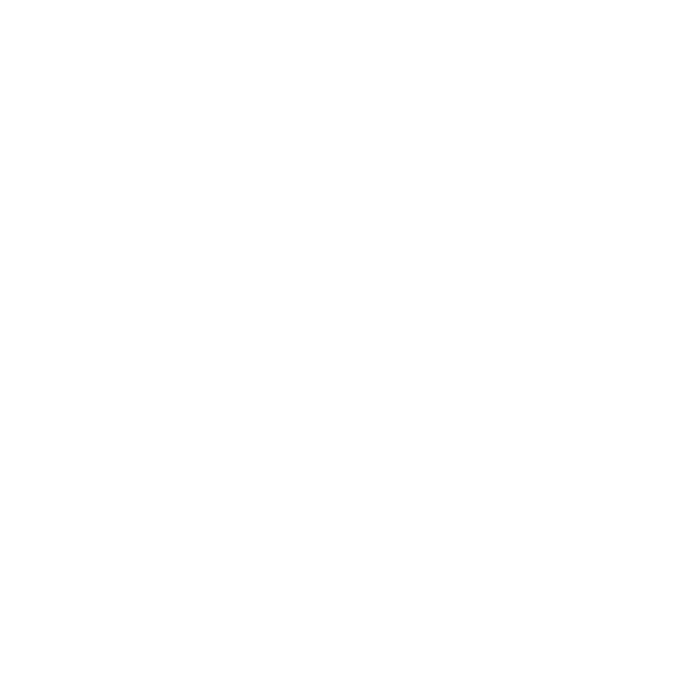Sie möchten bei uns spenden?
Unsere Geschicke hängen von vielen Faktoren ab – einer davon sind Spenden.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
Kontakt
Bürozeiten
Mo.-Fr. 8 - 16 Uhr
Kinderhaus:
06192 3 09 20-25
Ambulanter Pflegedienst:
06192 3 09 20-20
Integrationshilfe:
06192 3 09 20-19
Familienhilfe:
06192 3 09 20-16
Geschäftsleitung:
06192 3 09 20-40
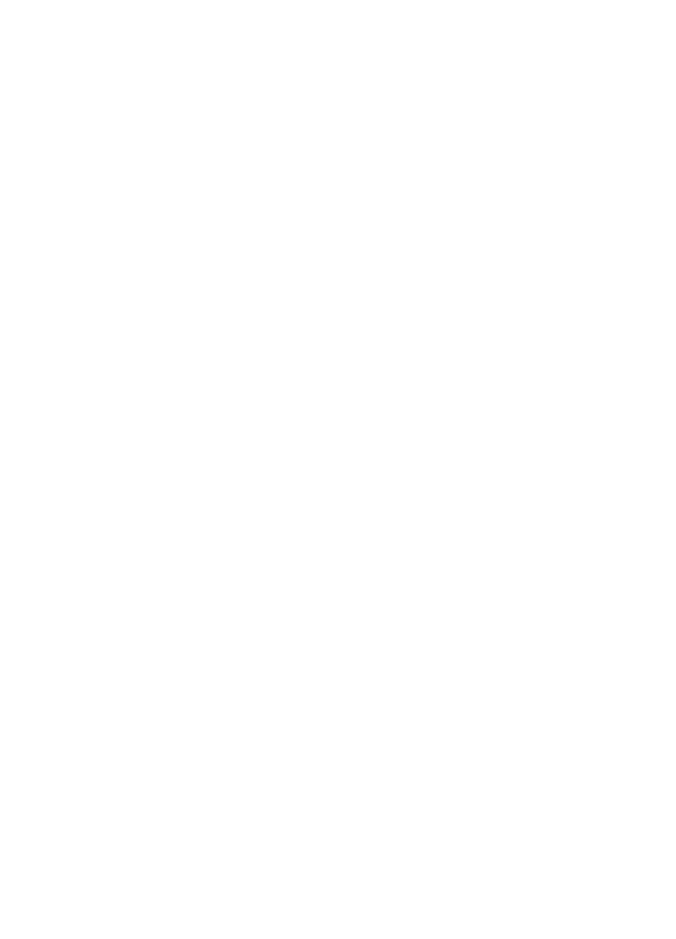
Aktuelles
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien und Impressum.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten.
Youtube
Wir benutzen Youtube für das Anzeigen der Videos, damit erklären Sie sich einverstanden, dass Youtube die Cookies in Ihrem Browser speichert etc.
Statistik
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.